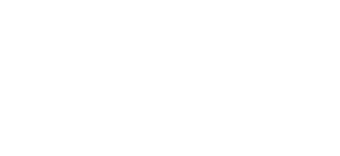Die Orgelmusik von Betsy Jolas
Die Orgelmusik von Betsy Jolas
KI-Übersetzung mit ChatGPT aus dem Französischen
Weit entfernt von den Klischees, die man gewöhnlich mit der Orgel verbindet, erklingt die Orgelmusik von Betsy Jolas mit derselben erfinderischen Fülle, die ihr gesamtes Schaffen prägt. Sie erkundet die vielfältigen Möglichkeiten des Instruments – sowohl als Soloinstrument (Angela Metzger) als auch im Dialog mit einem Kammerorchester (dem SWR Köln).
Betsy Jolas liebt die Orgel – ein Instrument, das sie während ihrer Ausbildung in Princeton kennenlernte. Diese nahezu vollständige Gesamteinspielung – nur Musique d’autres jours für Violoncello und Orgel (2020) fehlt – vereint vier Werke, die schon durch ihre Titel von einer Musik zeugen, die tief im alltäglichen Erleben wurzelt.
Leçons du Petit Jour (2007) ist eine Hommage der Komponistin an ihren Lehrer Messiaen – mit stilisierten Vogelgesängen und Naturgeräuschen, frei schwebenden Figuren auf einer stillen Klangfläche, die sogleich wieder verfließen. Jolas lässt uns dem Entstehen des Klangs lauschen, wählt ihre Farben mit Bedacht und spielt gelegentlich mit den mechanischen Geräuschen des Instruments: klangliche Einfälle und katzenhafte Arabesken, die jenen flüchtigen Moment des Tages musikalisch spiegeln.
Musique de jour beginnt mit einem G, einem Ton, der – so verrät sie – in ihrem Schaffen eine zentrale Rolle spielt und viele ihrer Klavierwerke eröffnet: ein fester Bezugspunkt, fast wie das „Ison“ bei Varèse, um das sich der polyphone Raum entfaltet. In der Mitte des Stücks entsteht daraus ein kunstvoller vierstimmiger „Fugato“.
In Musique d’Hiver (1971) für Orgel und Kammerorchester – dem wohl erstaunlichsten Werk dieser Aufnahme – wird die Orgel des Klaus-von-Bismarck-Saals in Köln zum Klanggenerator, und die Partitur, ohne Taktstriche oder Maßangaben, zum Gefäß unbegrenzter Möglichkeiten. Die Rolle des Schlagzeugs, die räumliche Aufsplitterung und die eruptiven Akkordblöcke erinnern erneut an Varèse. Keine Violinen, dafür zehn Bratschen und sechs Kontrabässe, dazu Klavier und Harfe. Die Orgel fügt ihre Farben zu einer virtuosen, funkelnden Textur, die zwischen klanglicher Transparenz (im Wechsel der Timbres) und dichter Klangfülle changiert, genährt vom vollen Spiel der Orgel und den mitreißenden Ausbrüchen des Schlagwerks. Mit sichtlicher Freude – und feinem Humor (etwa im jazzigen Kontrabass-Solo) – zeigt sich hier Jolas’ Ideal einer lebendigen, freien Musik, die von Angela Metzger und Titus Engel mit dem SWR Köln glänzend umgesetzt wird.
Die Trois Études Campanaires, ursprünglich für das Glockenspiel von Saint-Germain l’Auxerrois geschrieben, werden hier auf einer Kirchenorgel gespielt – derjenigen der Kirche St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel –, deren Schlagwerke (Celesta, Marimba und Glockenspiel) sich als ideal erweisen. Freie Polyrythmik überlagert Celesta, Marimba und Glockenspiel in der ersten und letzten Etüde, während in der zweiten die wandernde Linie der Celesta bezaubert. Diese Musik ist minimalistisch, allein dem Reiz des Klanges gewidmet – und bekräftigt einmal mehr Jolas’ Vorliebe für seltene Klangfarben und unerhörte Mischungen.
Michèle Tosi
ResMusica, 2. November, 2025